Verfahrensübersicht
Die im Folgenden dargestellten QS-Verfahren gruppieren sich in zwölf Versorgungsbereiche mit jeweils einem oder mehreren QS-Verfahren.
Die ersten zehn Versorgungsbereiche sind alphabetisch nach medizinischen Fachbereichen angeordnet. Danach folgen zwei thematisch übergreifende Versorgungsbereiche (Hygiene und Infektionsmanagement, Entlassmanagement).
Grundlage für die Durchführung der QS-Verfahren sind die Richtlinien des G-BA. Die meisten QS-Verfahren sind in der "Richtlinie zur datengestützten einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung" (DeQS-RL) gefasst.
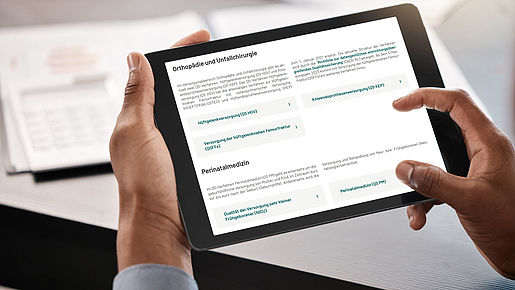
Qualitätssicherungsverfahren in Zahlen (Auswertungsjahr 2024)
5
Verfahren in Entwicklung
16
Qualitätssicherungsverfahren nach DeQS-Richtlinie
428
Qualitätsindikatoren und Transparenzkennzahlen
ca. 9,9 Mio
Vom IQTIG nach DeQS verarbeitete Datensätze
Gefäßchirurgie
In der Gefäßchirurgie bezieht sich die gesetzlich verpflichtende Qualitätssicherung auf eingreifende (invasive) Therapieformen, die sich dem Krankheitsbild der verengten Halsschlagader(n) widmen.
Eine Verengung der Halsschlagader (Karotis, lat. Arteria Carotis) geht mit einem erhöhten Risiko für Durchblutungsstörungen im Gehirn einher. Ziel der Behandlung ist daher die Wiederherstellung bzw. Verbesserung des Blutflusses (Karotis-Revaskularisation).
Hauptursache für die Verengung der Karotis ist die Arterienverkalkung.
Von einem Schlaganfall spricht man, wenn durch eine massive Verengung oder einen Verschluss der Karotis oder Abschwemmungen von Kalkablagerungen aus der Gefäßwand eine Mangeldurchblutung (Ischämie) des Gehirns entsteht. Dies ist ein medizinischer Notfall.
Durch eine Karotis-Revaskularisation lässt sich die Gefäßverengung behandeln, die Eingriffe erfolgen in der Regel einseitig, in seltenen Fällen auch beidseitig.
Gynäkologie
Das medizinische Fachgebiet der Gynäkologie beschäftigt sich mit der Lehre und Therapie der Erkrankungen der weiblichen Fortpflanzungsorgane. Zu den Schwerpunkten des Fachgebietes zählen die Geburtshilfe, die gynäkologische Onkologie sowie die Urogynäkologie.
Das entsprechende Fachgebiet für männliche Patienten ist die Andrologie, zum Teil die Urologie.
Kardiologie und Herzchirurgie
Im Versorgungsbereich Kardiologie und Herzchirurgie führt das IQTIG aktuell drei QS-Verfahren durch. Sie befassen sich mit der operativen bzw. kathetergestützten Versorgung des Herzens sowie gegebenenfalls auftretenden Komplikationen. Ist der Herzschlag durch Störungen der Reizbildung oder Reizleitung zu langsam (bradykarde Herzrhythmusstörung), werden, nach Ausschluss reversibler Ursachen, Herzschrittmacher eingesetzt.
Bei lebensbedrohlichen, schnellen Herzrhythmusstörungen kommt ein zuvor implantierter Kardioverter-Defibrillator (implantable cardioverter-defibrillator, ICD) zum Einsatz. Er hat zum Ziel, den schnellen Herzschlag zu normalisieren (QS-Verfahren Versorgung mit Herzschrittmachern und implantierbaren Defibrillatoren).
Die bildgebende Darstellung der Herzkranzgefäße wird als Koronarangiographie bezeichnet. Eine anschließende perkutane Koronarintervention (PCI) ermöglicht die Aufdehnung von Verengungen der Herzkranzgefäße mittels Ballon bzw. Stent (QS-Verfahren Perkutane Koronarangiographie (PCI) und Koronarangiographie).
Kann die Verengung der Herzkranzgefäße nicht durch eine PCI erfolgen, ist eine Bypass-Operation notwendig. Erkrankungen der Herzklappen (undichte bzw. verengte Klappen) können sowohl kathetergestützt als auch offen-chirurgisch versorgt werden (QS-Verfahren Koronarchirurgie und Eingriffe an Herzklappen).
Orthopädie und Unfallchirurgie
Verletzungen an der Hüfte oder am Knie ziehen häufig den Einsatz künstlicher Gelenke nach sich. Hier setzen die QS-Verfahren des Versorgungsbereiches an.
Das QS-Verfahren Hüftgelenkversorgung (QS HGV) hat am 1. Januar 2021 die ehemaligen Verfahren zur Hüftgelenknahen Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung (HUEFTFRAK-OSTEO) und Hüftendoprothesenversorgung (HEP) ersetzt.
Das QS-Verfahren Knieendoprothesenversorgung (QS KEP) befasst sich mit mehreren medizinischen Leistungen im Zusammenhang mit künstlichen Kniegelenken.
Am 15. November 2023 startet erstmals die Datenerhebung im Verfahren Versorgung der hüftgelenknahen Femurfraktur (QSFFx).
Perinatalmedizin
Die Perinatalmedizin spezialisiert sich auf die gesundheitliche Versorgung von Mutter und Kind im Zeitraum kurz vor bis kurz nach der Geburt (Geburtshilfe). Das IQTIG führt in diesem Versorgungsbereich das gleichnamige QS-Verfahren Perinatalmedizin (QS PM) durch.
Dieses QS-Verfahren kümmert sich einerseits um die geburtshilfliche Versorgung. Andererseits betrachtet es die Versorgung und Behandlung von Neu- bzw. Frühgeborenen (Neonatologie).
Pflege
Ein Dekubitus ist eine durch länger anhaltenden Druck entstandene Wunde der Haut bzw. des darunterliegenden Gewebes. Er stellt eine sehr ernst zu nehmende Komplikation bei zu pflegenden Patientinnen und Patienten dar. Darauf fokussiert das QS-Verfahren Dekubitusprophylaxe (QS DEK).
Für die Betroffenen ist ein Dekubitus oft sehr schmerzhaft und geht in vielen Fällen mit einem hohen Leidensdruck und einer eingeschränkten Lebensqualität einher. Ziel des QS-Verfahrens ist daher die Verbesserung der Prozess- und Ergebnisqualität, damit möglichst wenig neue Dekubitalulcera entstehen.
Psychiatrische und Psychotherapeutische Versorgung
Aktuell führt das IQTIG das Verfahren Ambulante psychotherapeutische Versorgung gesetzlich Krankenversicherter (QS Ambulante Psychotherapie) durch. Der am 1. September 2024 in Kraft getretene Beschluss des G-BA regelt die Anforderungen an die Prozess- und Ergebnisqualität der ambulanten psychotherapeutischen Versorgung gesetzlich krankenversicherter erwachsener Patientinnen und Patienten in Kurz- oder Langzeittherapie als Einzelbehandlung. Das Verfahren wird ab dem 1. Januar 2025 für sechs Jahre in Nordrhein-Westfalen regional erprobt.
Hinzu kommt eine Strukturabfrage auf Basis der Richtlinie zur Personalausstattung Psychiatrie und Psychosomatik (PPP-RL).
Darüber hinaus entwickelt das IQTIG das Verfahren Schizophrenie. Es zielt auf die Förderung und Verbesserung der Versorgungsqualität von volljährigen Patienten und Patientinnen mit Schizophrenie, schizotypen und wahnhaften Störungen ab.
Transplantationsmedizin und Nierenersatztherapie
Im Versorgungsbereich Transplantationsmedizin und Nierenersatztherapie bei chronischem Nierenversagen einschließlich Pankreastransplantationen sind mehrere getrennt betrachtete Auswertungsmodule vereint. Die einzelnen Module nehmen unter anderem ggf. auftretende Komplikationen sowie das (Langzeit-)Überleben der Patientinnen und Patienten in den Blick.
Das QS-Verfahren Transplantationsmedizin (QS TX) betrachtet die Lebendspende und Transplantation u.a. von Niere, Leber, Lunge und Herz sowie den Einsatz von Herzunterstützungssystemen / Kunstherzen.
Im QS-Verfahren Nierenersatztherapie bei chronischem Nierenversagen einschließlich Pankreastransplantationen (QS NET) werden neben z.B. Nieren- und Pankreastransplantationen auch Patientinnen und Patienten fokussiert, die eine ambulanten oder teilstationäre Dialyse erhalten.
Urologie
Das Versorgungsgebiet der Urologie beschäftigt sich mit den harnbildenden und harnableitenden Organen Niere, Harnblase, Harnleiter und Harnröhre bei beiden Geschlechtern sowie den männlichen Geschlechtsorganen, wie z.B. Prostata, Hoden und Samenleiter.
Das IQTIG entwickelt derzeit im Auftrag des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) das neue QS-Verfahren Lokal begrenztes Prostatakarzinom (QS Prostata-CA). Basis für die Entwicklung ist die vom IQTIG vorgelegte Konzeptstudie vom 30. November 2017.
Viszeralchirurgie
Die Viszeralchirurgie beschäftigt sich mit Operationen im Bauchraum und der Bauchwand, der endokrinen Drüsen und der Weichteile einschließlich Transplantation.
Das IQTIG führt hier aktuell das QS-Verfahren Cholezystektomie (QS CHE) durch. Das Verfahren nimmt stationär durchgeführte Gallenblasenentfernungen (Cholezystektomien) bei gesetzlich versicherten Patientinnen und Patienten in den Blick.
Bei der operativen Versorgung eines Gallensteinleidens können vereinzelt schwerwiegende Komplikationen auftreten, wie z. B. Verletzungen der Gallenwege oder der Blutgefäße. Die Häufigkeit solcher Ereignisse wird im QS-Verfahren Cholezystektomie beobachtet und analysiert.
Hygiene und Infektionsmanagement
Der Versorgungsbereich Hygiene und Infektionsmanagement umfasst zwei QS-Verfahren zu ambulant oder stationär erworbenen Infektionen.
Das Verfahren zur Ambulant erworbenen Pneumonie (QS CAP) nimmt die Behandlung von Lungenentzündungen als der häufigsten durch eine Infektion bedingten Todesursache in Deutschland in den Blick.
Das Verfahren Vermeidung nosokomialer Infektionen – postoperative Wundinfektionen (QS WI) addressiert die Behandlung von Wundinfektionen, die als Komplikationen nach einer Operation auftreten.
Ein drittes QS-Verfahren, das zur Diagnostik, Therapie und Nachsorge der Sepsis (QS SEPSIS) wird derzeit vom IQTIG im Auftrag des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) entwickelt.
Entlassmanagement
Reibungslose Übergänge an den Schnittstellen zwischen der (teil-)stationären Behandlung in einem Krankenhaus und der weiterführenden Versorgung im ambulanten oder einem anderen stationären Umfeld sind die Voraussetzung, um die Qualität der Versorgung von Patientinnen und Patienten sicherzustellen und Versorgungsbrüche zu vermeiden.
Ziel des Entlassmanagements ist es demnach, Patientinnen und Patienten bei der Bewältigung dieser Übergangsphase zu unterstützen.
So soll die Versorgungskontinuität gewährleistet und das Risiko vermeidbarer Wiederaufnahmen und anderer Komplikationen aufgrund von Versorgungslücken reduziert werden.
2018 hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) das IQTIG mit der Entwicklung eines sektorenübergreifenden, datengestützten QS-Verfahrens Entlassmanagement (QS ENTLASS) beauftragt.
Im Jahr 2020 hat das IQTIG den ersten Zwischenbericht dazu veröffentlicht.